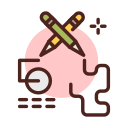Glasuren verstehen: Chemie, Farbe, Transparenz
Eine Glasur vereint Silika, Flussmittel und Tonbestandteile. Silika bildet das Glas, Flussmittel senken den Schmelzpunkt, Aluminiumoxid stabilisiert die Schicht. Oxide und Farbkörper schenken Farbe. Kleine Rezeptvariationen bewirken große Effekte. Teile deine Fragen zu Rohstoffen—wir antworten mit Tipps und erprobten Quellen für den sicheren Einstieg.
Glasuren verstehen: Chemie, Farbe, Transparenz
Pinsel, Tauchen, Gießen—jedes Verfahren hinterlässt eine eigene Handschrift. Erstelle Testkacheln mit dicken und dünnen Zonen, notiere Brennkurve und Auftrag. So erkennst du Läufer, Pinholes und Transparenz. Dokumentation ist dein Kompass. Lade Fotos deiner Kacheln hoch und erhalte Rückmeldungen aus der Community.